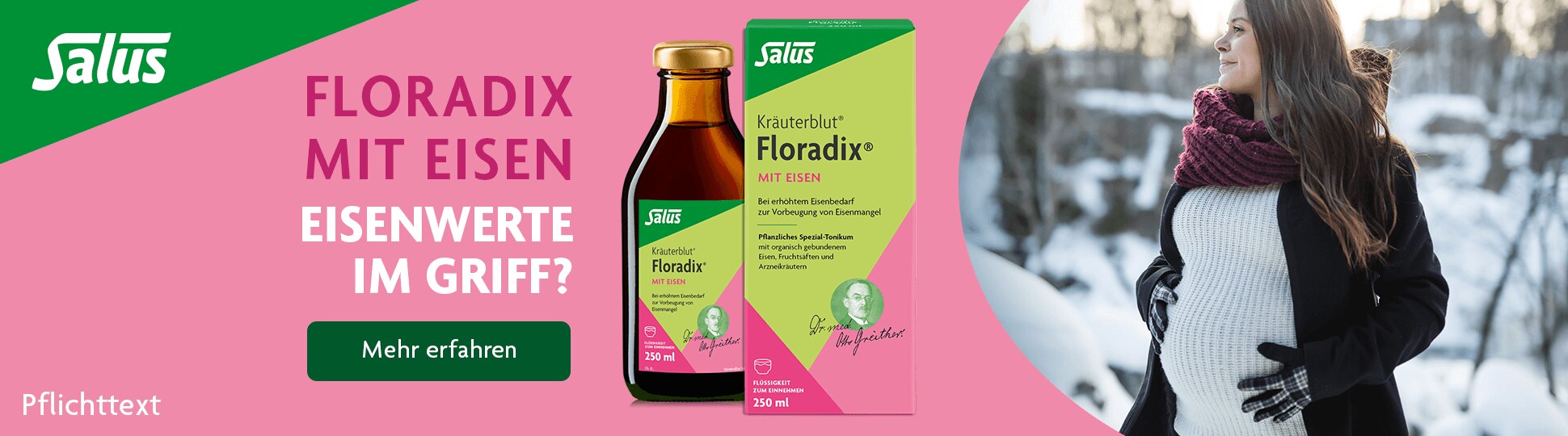nada2009
Sehr geehrter Dr Paulus, Ich bin in der 23 Woche schwanger. Ich plane nach Ausland zu fliegen und wollte Sie mal fragen, ob man in der Schwangerschaft bedenklos fliegen kann? Die Flugdauer ist 2,5 Stunden. Wie gefährlich sind die kosmischen Strahlung für das ungeborene Kind? Wie gefährlich sind die Sicherheitsmaßnahmen im Flughafen für das ungeborene Baby? Soll ich was besondres achten?? Danke SG
Bei Flugreisen sind drei Veränderungen in den Umgebungsbedingungen für Schwangere zu berücksichtigen: reduzierter Luftdruck, niedrige Luftfeuchtigkeit, kosmische Strahlung. Für die Schwangerschaft birgt das Fliegen in modernen Verkehrsmaschinen in körperlicher Ruhe als Passagier keine größeren Risiken. Die Abnahme des Sauerstoffpartialdruckes wird von Mutter und Fetus gut toleriert. Die zusätzliche geringe kosmische Strahlenbelastung auf Langstreckenflügen sollte grundsätzlich nicht zu einem Verzicht auf derartige Flüge veranlassen oder Ängste bezüglich Fehlbildungsrisiken auslösen. Angesichts der großen biologischen Variation des errechneten Geburtstermines sollte in den letzten 4 Wochen allenfalls nur auf Kurzstrecken geflogen werden. Verkehrsflugzeuge fliegen auf einer Höhe von 9.000 bis 12.000 Metern. Da der Luftdruck in dieser Höhe für den Menschen zu gering wäre, haben die Maschinen Druckkabinen, die jedoch aus technischen Gründen nicht den Druck am Boden erzeugen, sondern den einer Höhe von etwa 2.500 Metern. Deshalb ist an Bord weniger Sauerstoff in der Luft, was üblicherweise mit einem Anstieg der Herzfrequenz ausgeglichen wird. Entsprechend der Kabinenhöhe kommt es zu einem Abfall des Sauerstoffpartialdruckes in der Inspirationsluft. Damit sinken auch der alveoläre und arterielle Sauerstoffpartialdruckes in Bereiche, die z. B. für lungenkranke Personen grenzwertig werden können. Bei normalen Schwangerschaften reagiert der Körper der Mutter wie bei einem Normalpassagier, so dass auch für das Kind keine nachteiligen Wirkungen festgestellt werden können (Elliot & Trujillo 1987). Die Sorge um die Effekte der relativen Hypoxämie durch den verringerten Kabinendruck konnte durch Untersuchungen mit Schwangeren auf Europaflügen entkräftet werden (Huch et al 1986). Theoretische, höhenphysiologische Überlegungen und Erfahrungen aus Untersuchungen mit schwangeren Frauen unter echten Flugbedingungen zeigen, dass bei der normalverlaufenden Schwangerschaft keine Nachteile für die kindliche Sauerstoffversorgung zu erwarten sind (Huch et al 2001). Die flugspezifische Hypoxämie bei der schwangeren Frau ist so gering, dass Assoziationen zu Fehlbildungen, wie sie bei Flügen in der Frühschwangerschaft geäußert wurden, nicht zu begründen sind (Huch et al 1999). Während der Schwangerschaft besteht durch Veränderungen des Gerinnungssystems eine erhöhte Thromboseneigung. Die Immobilisierung bei Langzeitflügen kann das Thromboserisiko erhöhen (Cruikshank 1988). Die Wiener Konsensus-Konferenz zur Reisethrombose (Kluza 2001) stufte Schwangere aus diesem Grund in die Gruppe der Reisenden mit mittlerem Thromboserisiko ein. Schwangere sollten deshalb einer Thrombose vorbeugen, indem sie auf Beinbewegungsfreiheit achten, kein Handgepäck unter den Vordersitz klemmen, Beine bewegen, ausreichend trinken und Kompressionsstrümpfe tragen. Wann eine medikamentöse Prophylaxe notwendig ist, muss man im Einzelfall in Abhängigkeit von Schwangerschaftsstadium, Flugdauer und anamnestischen Risiken entscheiden. Die geringe Luftfeuchtigkeit bei erhöhtem Atemminutenvolumen der Schwangeren kann zu Dehydratation führen. Die Luftfeuchtigkeit liegt auf Langstreckenflügen oft unter 10%. Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sollte daher geachtet werden. Die Strahlendosis ist für jeden Flug unterschiedlich und sehr variabel. Sie schwankt in einem etwa elfjährigen Zyklus mit der Intensität des sogenannten Sonnenwindes. Daneben ist sie aber auch von der Flughöhe und der Flugroute abhängig, da sie mit der Höhe zunimmt und in der Nähe der Pole wesentlich stärker ist als am Äquator. In Abhängigkeit von Flugroute und -dauer resultiert bei einem Langstreckeneinzelflug eine kosmische Strahlenbelastung von 30 – 150 µSv, was etwa einem Hunderstel der Belastung bei ganzjähriger beruflicher Exposition entspricht. Danach beträgt die Belastung auf einem dreizehnstündigen Flug von München nach San Francisco im Durchschnitt etwa 70 µSv, bei dem annähernd gleich langen Flug nach Sao Paulo dagegen weniger als die Hälfte. Eine Reise von Frankfurt nach Palma de Mallorca wird wegen der geringeren Höhe und Dauer lediglich mit 3 µSv veranschlagt. Bei einem transpolaren Flug zwischen New York und Tokio erreicht die Strahlenbelastung hingegen 150 µSv (Barish 2004). Im Vergleich dazu beträgt die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland, der alle Menschen ständig ausgesetzt sind, im Durchschnitt etwa 2.500 µSv pro Jahr. Dazu kommt noch einmal etwa die gleiche Dosis durch künstliche Strahlenquellen, wie medizinische Untersuchungen, Kernkraftwerke, Fernsehröhren oder Rauchen. Gerade die natürliche Strahlenbelastung ist aber sehr variabel und hängt vom Wohnort ab. Die Strahlenbelastung eines Fluges Frankfurt-San Francisco entspricht zwei Röntgenaufnahmen des Thorax. Da der Fet bei einer Thoraxaufnahme nicht im Strahlengang liegt, bekommt er als Streustrahlung jedoch nur einen Bruchteil dieser Dosis ab. Im Flugzeug dagegen ist der ganze Körper der Mutter im Strahlenfeld der kosmischen Strahlung und damit auch der Fet. Komplikationen wie Aborte, geistige Retardierung, kongenitale Fehlbildungen und Wachstumsretardierung als Folge einer Strahlenbelastung treten nach einhelliger Expertenmeinung erst bei Strahlendosen über 20 mSv auf (Brent 1989). Die ionisierende Strahlung kann daher vernachlässigt werden, sofern es sich nicht um Dauerexposition bei Flugpersonal handelt. Die International Commission on Radiological Protection rät, eine jährliche Strahlenbelastung aus künstlichen Quellen von 1 mSv nicht zu überschreiten. Diese Empfehlung gilt auch für die intrauterine Exposition des Feten (IRCP 1991). Bei intakter Gravidität sind Flugreisen nicht bedenklich. Lediglich eine berufliche Dauerexposition sollte wegen der Höhenstrahlung vermieden werden. Bedenklich wären insbesondere häufige lange Interkontinentalflüge.